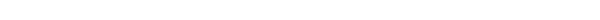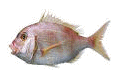Legasthenie
|
 back back next next
|
 Welche
Möglichkeiten der Unterstützung
gibt es für betroffene Kinder im Vorschulalter?
Welche
Möglichkeiten der Unterstützung
gibt es für betroffene Kinder im Vorschulalter?
Diagnose und Förderung sprachbezogener Wahrnehmungsleistungen:
Folgende fünf Wahrnehrnungsbereiche sind essentiell
für das Lesenlernen am Schulanfang:
| 1. |
Die phonematisch-akustische
Differenzierungsfähigkeit (ein Phonem gleich ein Sprechlaut): |
| 2. |
Die sprechmotorisch-kinästhetische
Differenzierungsfähigkeit |
| 3. |
Die intonatorisch-melodische
Differenzierungsfähigkeit |
| 4. |
Die rhythmische Differenzierungsfähigkeit |
| 5. |
Die optisch-graphomotorische
Differenzierungsfähigkeit |
Funktionen nicht isoliert üben!
Es geht bei der vorbeugenden Förderung nicht um ein isoliertes Training für einzelne Sinnesbereiche (Sinnesschulung), sondern darum, im Spielalltag des Kindes die Tätigkeit mit Anforderungen anzureichern, welche die Genauigkeit der Wahrnehmung fördern und verbessern helfen. Eine spielerische Basisförderung stabilisiert und automatisiert auch die sprachbezogenen Wahrnehmungen. Unterstützt wird dies, wenn in der Förderung die Einheit von Tätigkeit, positiver Motivation und Sprechen verwirklicht wird. Ohne dass das Kind schreibt oder liest, wird es auf das Schreiben und Lesen vorbereitet.
In der konkreten Förderung ist daher immer zu beachten, dass jeder einzelne sprach bezogene Wahrnehmungsbereich zwar seine spezifische Funktion besitzt, aber zugleich ein Teil eines Bündels elementarer Lern Voraussetzungen ist. Die Übungen für einzelne Wahrnehmungsbereiche sollten daher immer eingebettet sein in sprachliche Situationen, in denen auch andere Wahrnehmungsbereiche beteiligt sind. Die Frühförderung der mit Sprache verbundenen Wahrnehmungsleistungen bedeutet zugleich auch eine Förderung der Konzentrationsfähigkeit und des Sprachgedächtnisses. Konzentrationsschwäche bei Schülern ist oft nicht der primäre Ausgangspunkt für Lernschwierigkeiten, sondern die Folge unscharfer Wahrnehmungen für die Informationsverarbeitungen.
Der Erfolg einer vorbeugenden Förderung
hängt nicht nur von ihrer didaktischen Gestaltung ab. Ebenso wichtig
ist die Atmosphäre, in der sie sich vollzieht. Es kommt darauf an, wie
die psychosozialen Grundbedürfnisse des Kindes
nach Liebe, Geborgenheit und Zuneigung, nach Bestätigung, Anerkennung
und Hilfe, nach Erkenntnisgewinn, Lern- und
Erfahrungszuwachs, nach Selbsterfahrung und Freiräumen befriedigt
werden.
 Beispiele
für Förderübungen
Beispiele
für Förderübungen
Ergänze die Silben. Welche passt zum Bild?
|
|
|||||||
 Programm
für Kinder im Vorschulalter
Programm
für Kinder im Vorschulalter
An dieser Stelle sei verwiesen auf folgendes :
Petra Küspert & Wolfgang Schneider (1999); Hören, lauschen,
lernen Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter;
Vandenhoeck & Rupprecht
Dabei handelt es sich um einen Übungsplan,
bei dem für insgesamt 20 Wochen verschiedene Aufgabensätze zu
verschiedenen Bereichen der Sprecherziehung zusammengefasst wurden. Ein
zentrales Konzept stellt hierbei die sog.
"phonologische Bewusstheit" (= Zuordnung von Buchstaben zu Lauten beim
Rechtschreiben, oder umgekehrt die
Zuordnung von Lauten zu Buchstaben beim Lesen, erfolgt auf der Basis
von Korrespondenzregeln, die je nach Lauttreue der
Sprache unterschiedlich streng sind) dar. Täglich sollten zehn Minuten
mit den betroffenen Kindern geübt werden.
Insgesamt gibt es sechs Aufgabenkategorien, die
aufeinander aufbauen:
1. Lauschspiele
2. Reime
3. Sätze und Wörter
4. Silben
5. Anlaute
6. Phoneme