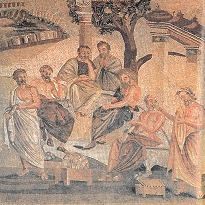Platon
|
 back back next next
|
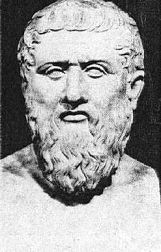 |
 Lebenslauf
Lebenslauf
| 427 v. Chr. |
Platon wurde in Athen geboren als Sohn einer Aristokratenfamilie. |
|
|
Als junger Mann verschrieb sich Platon der Politik, wurde von der politischen Führung Athens jedoch enttäuscht. Schliesslich wurde er Schüler des Sokrates und bekannte sich zu dessen Lehre. Er verurteilte dessen Hinrichtung und ging danach auf Reisen, die ihn u.a. nach Sizilien und Ägypten führten. |
| 387 |
Als er zurückkehrte, gründete Platon in Athen die Akademie. Ihr breitgefächerter Studienplan umfasste Astronomie, Biologie, Mathematik, politische Theorie und Philosophie. Der berühmteste Schüler der Akademie war Aristoteles. Die Akademie war elitär, sie war nicht jedem Bürger zugänglich. Einzig die Söhne des höchsten Standes hatten Zugang zur Akademie. Die Akademie war ein Park- Kult- und Sportbezirk, 1600m außerhalb Athens gelegen. Sie ist als Gemeinschaft von Forschenden, Lehrenden und Studierenden zu verstehen, in der es keine verbindlichen Vorschriften gab. |
|||
| 367 |
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Philosophie mit dem praktischen politischen Leben zu verbinden, ging Platon 367 v. Chr. nach Sizilien, um den neuen Herrscher von Syrakus, Dionysios II., in der Regierungskunst zu unterweisen, doch das Experiment scheiterte und Platon musste von einem Freund auf dem Sklavenmarkt freigekauft werden. |
|||
| 347 |
Tod im hohen Alter von 80 Jahren. |
|
 Ideenlehre
Ideenlehre
Für Platon sind die Ideen eine eigene Wirklichkeit hinter der Sinnenwelt. Sie ist der Sinnenwelt übergeordnet. Aus diesen geistigen, immateriellen Urbildern werden in der Realität Abbilder geformt.
 |
Diese Urformen nennt Platon Ideen. Es gibt somit zum Beispiel eine Idee Mensch, eine Idee Pferd oder eine Idee Baum.Die Ideen sind ungeworden und unvergänglich, absolut. Die höchste Idee und letztes Prinzip ist die Idee des Guten. Eros ist für das Streben nach dem Guten die treibende Kraft. Er erwacht beim Anblick des Schönen und strebt vom Sterblichen zum Unsterblichen, vom Sinnlichen zum Geistigen und vom Besonderen zum Allgemeinen. Die Ideen stellen die seiende Welt dar. Sie sind nicht wahrnehmbar mit unseren Sinnen, aber erkennbar durch unsere Vernunft. Durch das Mitwirken der vernunftlosen Materie können die Abbilder der Ideen jedoch nie so vollkommen sein wie die Ideen selbst. |
 Das
Höhlengleichnis
Das
Höhlengleichnis
Das Höhlengleichnis, stellt sinnbildlich den Aufstieg von der Realität zu den Ideen dar. Das menschliche Dasein wird dargestellt als eine unterirdische Höhle, in der die Menschen so gefesselt sind. Sie können nur an eine Wand der Höhle blicken. Auf diese werden durch ein Feuer im Hintergrund Schatten von Gegenständen abgebildet. Diese Schattenbilder stellen die Erscheinung irdischer Dinge dar. Die gefesselten Menschen halten diese für die Realität. Einer der Menschen befreit sich von den fesseln, wendet sich um und erkennt, dass die Schatten nur Abbilder dieser Dinge sind. Beim Austritt aus der Höhle blendet ihn zuerst das Tageslicht und er erkennt zunächst nur Schatten und Widerspiegelungen. In einem Gewöhnungsprozess wird er dann aber die Dinge selbst und zuletzt die Sonne, Sinnbild der Ideen, sehen. Er erkennt, dass sie die tiefere Ursache allen Seins ist. |
 Werke von
Platon
Werke von
Platon
Platon schrieb sein Werk in der Form sokratischer Dialoge, in denen anhand von Gesprächen zwischen zwei oder mehreren Personen philosophische Gedanken vorgetragen, diskutiert und kritisiert werden. Nach der Entstehungszeit werden sie in frühe, mittlere und späte Dialoge eingeteilt.
a) frühe Schriften
| Apologie: Nachdichtung der Verteidigungsrede des Sokrates in dem gegen ihn geführten Gerichtsverfahren. | |
| Kriton: Über die Hochachtung der Gesetze. | |
| Protagoras: Eine Auseinandersetzung mit der Sophistik über die lugend, insbesondere ihre Einheit und die Frage ihrer Lehrbarkeit. |
b) Schriften der Übergangsperiode
| Gorgias: Auch hier steht im Mittelpunkt die Tugend und die Frage, ob sie lehrbar ist. Die egoistische Moral der Sophisten wird als ungenügend erwiesen. Die Rhetorik genügt nicht als Bildungsmittel. Das sittlich Gute ist ein Unbedingtes und wird metaphysisch begründet. | |
| Menon: Über das Wesen der Erkenntnis und die Bedeutung der Mathematik. | |
| Kratylos: Über die Sprache. |
c) Schriften in Platons Lebensmitte
| Symposion: Über den Eros bildet als treibende Kraft des philosophischen Strebens nach dem Schönen und Guten. | |
| Phaidon: Über die Unsterblichkeit, Übersinnlichkeit und Ewigkeit der Seele. Ausgestaltung der platonischen Ideenlehre. | |
| Politeia: Der Staat. Das umfangreichste Werk Platons | |
| Theaitetos: Über das Wesen des Wissens |
d) Platons Spätwerk
|
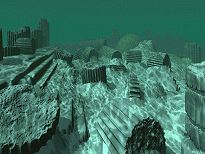 |
 Weblinks
Weblinks
| www.philosophenlexikon.de | |
| de.wikipedia.org | |
| www.gottwein.de | |
| www.info-antike.de | |
| db.icontent.ch | |
| www.fb.ze.tu-muenchen.de |